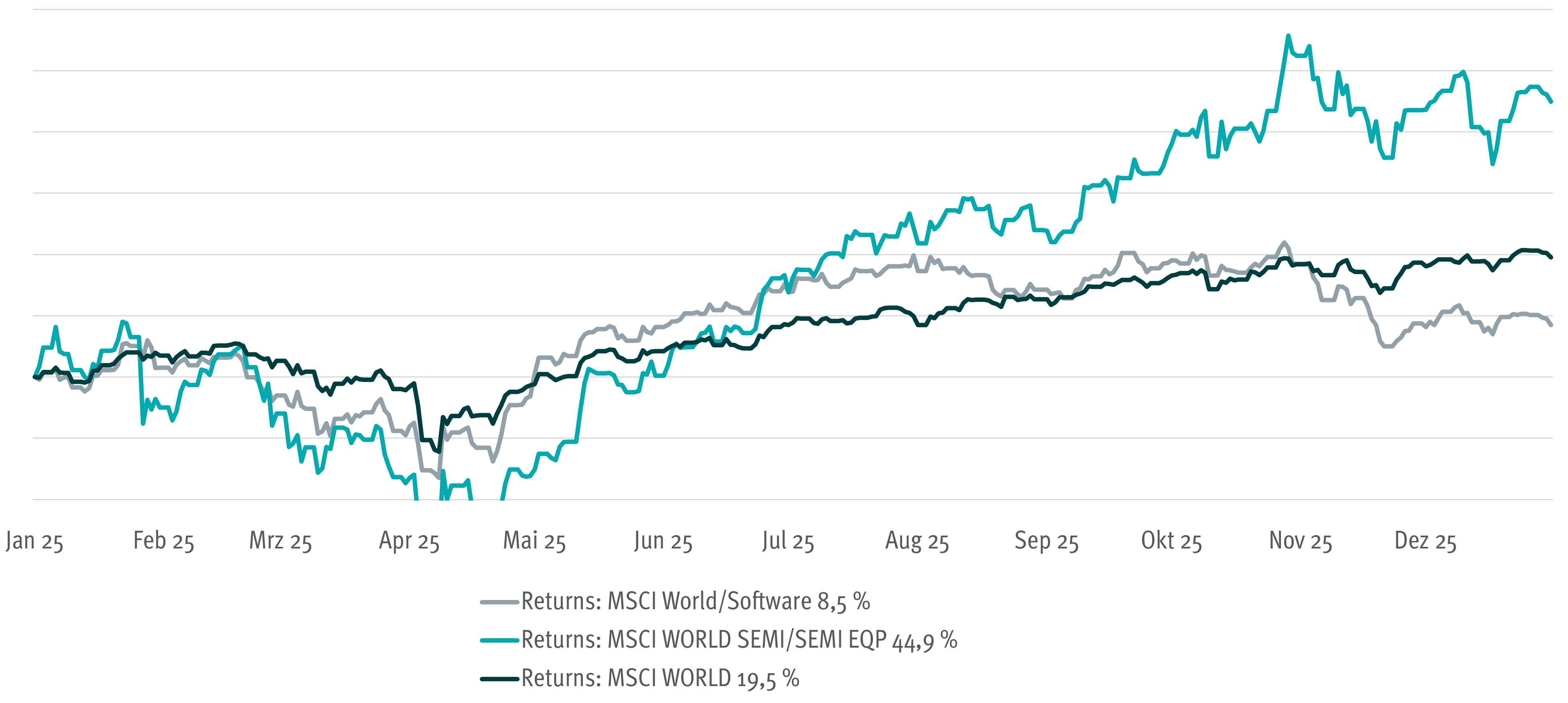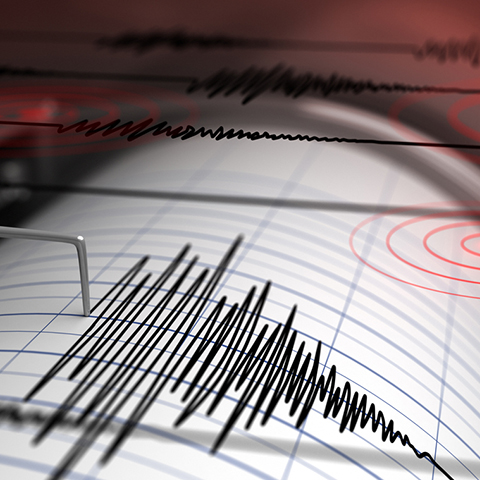AG: Wie unterscheiden sich Private Cloud und Colocation davon?
DP: Private-Cloud- und Colocation-Rechenzentren bieten sicheren, mehrmandantenfähigen Rechenzentrumsraum sowie Strom, Kühlung und Konnektivität. Typische Mieter sind Banken, Versicherer, das Gesundheitswesen, die öffentliche Hand und Industrie- oder Tech-Unternehmen.
Diese Standorte liegen meist stadtnah, carrier-neutral bzw. netzbetreiberunabhängig angebunden und mit sehr geringen Latenzen zu den Nutzerstandorten. Oft sind sie eng in regionale Ökosysteme eingebettet – etwa lokale Finanzplätze oder Behörden-Cluster. Das schafft starke Standortbindung, gute Wiedervermietbarkeit und ein gewisses Preisanpassungs-Potenzial, insbesondere in Märkten mit knapper Strom- und Flächenverfügbarkeit.
Die Use Cases reichen von streng regulierten Anwendungen über Disaster-Recovery-Sites bis hin zu hybriden Cloud-Architekturen, bei denen unternehmenskritische Workloads nahe an Public-Cloud-On-Ramps betrieben werden. Der europäische Colocation-Markt liegt heute bei rund 20 Milliarden US-Dollar und könnte sich bis 2030 auf knapp 50 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln.
AG: Und was macht AI-Training-Rechenzentren so besonders?
DP: AI-Training-Rechenzentren sind das andere Ende der Skala. Sie sind auf das Training großer KI-Modelle und sehr rechenintensive Simulationen ausgelegt. Typisch sind 100 MW IT-Leistung und mehr, extrem dichte Racks – teilweise zehnmal dichter als in klassischen Cloud-RZ – und zunehmend Flüssigkühlung.
Latenz ist beim Training weniger kritisch als bei der Inferenz. Deshalb entstehen viele dieser Standorte bewusst abseits der Metropolen, dort, wo günstige, möglichst CO2-arme Energie und ausreichend Fläche vorhanden sind. Hohe Bandbreiten werden dann über Ferntrassen angebunden. Das reduziert die Bedeutung der Mikrolage und damit auch das Wiedervermietungs-Potenzial.
Mieter sind Hyperscaler oder spezialisierte „Neoclouds“, die GPU-Kapazität als Service anbieten. Vertragslaufzeiten sind tendenziell kürzer. Anders als bei stadtnahen Hyperscale- oder Colocation-Objekten sehen wir hier kein strukturelles Preisanpassungs-Upside, sondern eher asymmetrische Risiken: Fallen GPU-Preise oder steigt der Wettbewerb, kann Druck auf die Mieten kommen – und alternative Nutzungen des Standorts sind begrenzt.
Trotzdem wächst der europäische GPU-as-a-Service-Markt mit über 20 Prozent pro Jahr. Auf Service-Ebene ist das das wachstumsstärkste Segment; auf Immobilienebene aber klar das risikoreichste.
AG: Wie groß ist der Investitionshunger der großen Cloud-Anbieter und Neoclouds?
DP: Sehr groß. Schätzungen gehen davon aus, dass die kumulierten Investitionen von Hyperscalern in Rechenzentren, CPUs/GPUs und cloud-gehostete Infrastruktur zwischen 2015 und 2030 knapp 1 Billion US-Dollar erreichen. Und das ist nicht nur ein Thema der etablierten „Traditional Hyperscalers“, sondern zunehmend auch der AI-spezifischen Neocloud-Anbieter.
Wir sehen dabei einen deutlichen Strategiewechsel: AI-Trainingskapazitäten wandern verstärkt in Tier-II-Regionen mit niedrigeren Stromkosten, verfügbarer Fläche und einer positiven Regulierung.
Latenz ist beim Training weniger kritisch, dadurch werden periphere Märkte mit guter Energie- und Glasfaseranbindung interessant.
Parallel bleiben Tier-I-Märkte wichtig. Ab den 2030er Jahren wird die breite Ausrollung von AI-Inference eine neue Welle von Rechenzentren in latenzsensitiven Hubs auslösen. Für Europa heißt das: Ein Teil der AI-Trainingslast geht in Regionen wie die Nordics, die Iberische Halbinsel oder Osteuropa. Gleichzeitig erleben Core-Märkte wie Frankfurt, London, Amsterdam oder Paris durch den Inference-Roll-out eine zweite Wachstumswelle.
AG: Wenn wir auf Risiko und Rendite schauen: Wie unterscheiden sich die drei Segmente?
DP: Wir betrachten vor allem drei Risikodimensionen als größte Diversifikationen: Kontrahentenrisiko, Entwicklungsrisiko und Preisanpassungsrisiko.
► Public Cloud: Langfristige Verträge mit Hyperscalern, hohe Eintrittsbarrieren, überschaubares Entwicklungsrisiko, aber begrenztes Upside bei Preisanpassungen. Das passt gut zu Core- und Core-Plus-Investoren.
► Private Cloud/Colocation: Breitere Mieterbasis, mittlere Vertragslaufzeiten, solide Nachfrage in regulierten Sektoren. Hier sind höhere Renditen möglich, aber mit mehr Mieter- und Preisanpassungsrisiko. Typisch eher Core-Plus.
► AI Training: Höchste technische Komplexität, anspruchsvolle Standortanforderungen und starke Abhängigkeit von einem dynamischen Marktumfeld. Entwicklungs- und Preisanpassungsrisiken sind deutlich höher; das Renditepotenzial liegt vor allem im Service-Layer. Das eignet sich eher für Core-Plus-/Value-Add-Strategien mit hoher Expertise.
AG: Welche Rolle spielt Europa in dieser Entwicklung?
DP: Europa steht vor einem massiven Ausbau seiner digitalen Infrastruktur. Programme wie InvestAI auf EU-Ebene und nationale KI-Strategien adressieren sowohl zusätzliche Cloud-Kapazitäten als auch spezialisierte KI-Rechenzentren. Verschiedene Studien gehen davon aus, dass sich die installierte Rechenzentrumskapazität in Europa in den nächsten fünf bis sieben Jahren nahezu verdreifachen könnte.
Für die Immobilienwirtschaft entsteht damit ein neues Spielfeld: Rechenzentren vereinen klassische Immobilienmerkmale – Grundstück, Gebäude, langfristige Nutzung – mit Infrastruktur- und Technologierisiken wie Stromversorgung, Netzanbindung oder IT-Obsoleszenz. Professionelle Betreiberplattformen, eine effiziente Nutzung von Wasser und Energie sowie aktives Risikomanagement werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor.
Oder anders gesagt: Ohne Rechenzentren gibt es keine skalierbare künstliche Intelligenz.
AG: Was ist dein Fazit für langfristig orientierte Investoren?
DP: Rechenzentren entwickeln sich rasant von einer technisch dominierten Nische zu einer strategisch wichtigen Assetklasse. Das Zusammenspiel aus strukturellem Datenwachstum, großen Investitionsbudgets der Hyperscaler und der zunehmenden Bedeutung von KI macht den Sektor sehr attraktiv.
Public-Cloud-Rechenzentren mit Hyperscalern als Mietern bieten ein vergleichsweise defensives Profil. Wer mehr Rendite sucht, findet in Colocation-Plattformen und AI-Training-Campus attraktive, wenn auch komplexere Opportunitäten. Entscheidend ist, die drei Segmente klar zu unterscheiden, die jeweiligen Risiken gezielt zu steuern – und Rechenzentren nicht nur als „Serverräume“, sondern als kritische Infrastruktur der digitalen Wirtschaft zu verstehen.
AG: Vielen Dank für den interessanten Austausch, David!